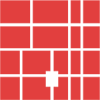Pflaumenregen, so der Titel von Stephan Thomes neuem Roman, bezeichnet eigentlich die Regenzeit in Fernost: 梅雨 (méi für Pflaume) bzw. japanisch Tsuyu sorgt im Mai/Juni verlässlich für große Niederschlagsmengen vor dem Sommer. Es regnet oft in Taiwan, und auch in Thomes Familienpanorama, das sich um die Frage von Identität und Heimat dreht, die den Autor auch persönlich berührt, denn er lebt seit Jahren dort. Für diese Frage ist Taiwan dankbar gewählt, seit Beginn der historischen Aufzeichnungen behaupten Menschen unterschiedlichster Herkunft ihre Ansprüche: Piraten und Spanier, Holländer, Chinesen, Japaner und wieder Chinesen. Seine eigene Meinung zu Taiwans jetzigem politischen Status stellt Thome bereits im Vorwort klar.
Der Roman wird erzählt entlang von zwei Strängen: in der Vergangenheit von 1942 bis ca. 1957 auf dem Lande im nördlichen Taiwan und in der Gegenwart, an einigen Sommertagen im Taipeh von 2016. Die kleine Umeko ist begeisterte Baseball-Anhängerin und spricht gutes Japanisch. Obwohl sie sich nicht fortbewegt, verliert sie ihre Heimat mit der Niederlage des japanischen Kaiserreiches. Von nun an soll sie Chinesin sein, doch die Festländer gerieren sich umso herrischer. Die Unruhen nach der offiziellen Übergabe an das Festland werden 1947 im sog. 228-Massaker blutig niedergeschlagen, ihr Onkel wird erschossen und ihr Bruder ohne Anklage eingesperrt.

In der (fast) Gegenwart kehrt der als junger Erwachsener in die USA emigrierte Harry (Hua-li) für ein paar Tage zurück. Er besucht seine Mutter (das kleine Mädchen Umeko aus den 40er Jahren), interessiert sich für die Familiengeschichte, will gar ein Buch schreiben: “Wir müssen unsere Geschichte allerdings selbst erzählen. Bisher haben es immer andere für uns getan. Das heißt, sie haben ihre Geschichte erzählt, wir kamen halt darin vor.” Doch ist es taiwanesische Geschichte, wenn sie der Deutsche Stephan Thome erzählt? Im Interview erklärt er in Bezug auf seine taiwanesische Frau und Familie: “Aus diesem Gefühl der Verbundenheit heraus habe ich den Roman begonnen – gar nicht in dem Gefühl, ich schriebe über ein fremdes Land, über eine andere Kultur, sondern ich schreibe über uns, über Menschen die ich kenne, über das, was im meinem Alltag wichtig ist. Vor fünf oder sechs Jahren hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, aus der Perspektive dieser Leute dort zu erzählen” [S. Thome, Interview für den Suhrkamp Verlag]. In seinem China-Roman ‹Gott der Barbaren› hatte Thome noch Deutsche und Engländer platziert, aus deren westlichen Augen erzählt wird.
Sprachlich gelingt es Thome, die Brüche und den Wandel des Lebens auf der Insel darzustellen. Die japanischen Kolonialherren sprechen indirekt, in der dritten Person Singular, sind übertrieben höflich und dabei hintenrum beleidigend. Die Änderung der nationalen Zugehörigkeit 1945 zwingt Charaktere und Erzähler zur chinesischen Sprache: Die Namen der Charaktere wechseln und die Enkelin korrigiert die Großmutter, die statt des chinesischen Ortsnamens noch den japanischen Ausdruck aus ihrer Kindheit verwendet. Die Gegenwart strotzt nur so von den Wörtern der 2010er Jahre: Emoji, Brexit, Pokemon Go, und SUV. Ganze Passagen sind nun in Fremdsprache gehalten, vornehmlich auf Englisch: Wenn etwa der Enkel aus Amerika nicht Chinesisch reden will oder der englische Freund in Fernbeziehung SMS schreibt, so greift Thome zum englischen Originalton. Glücklicherweise sind diese Sätze allesamt belanglos, vielleicht hatte hier auch der Verleger eingegriffen. Leider schreckt Thome nicht davor zurück, auch selten gebrauchte Wörter aus allen vier Sprachen in den Text mit aufzunehmen: “Bunun”, “Shaobing”, “Sou desu ka” und “PX” – Thomes Leser kennen diese Ausdrücke hoffentlich, denn selbst im Glossar am Ende sind sie nicht angegeben.
Die zwanzig Kapitel des Buches sind verschränkt erzählt, sodass die Handlung zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her springt. Man muss sich immer wieder neu orientieren, auch weil der Kapitelbeginn häufig lediglich mit “er” oder “sie” erfolgt anstelle der Klarnamen. Im Roman redet der Großvater, Umekos Mann, auch so und der Erzähler nennt es eine “Unsitte, fremde Namen durch Pronomen zu ersetzen”, die es sich “abzugewöhnen” gelte. Man kann nur hoffen, dass sich Thome beim Schreiben der Ironie dieser Textstelle bewusst war.
Doch die Charaktere sind in ihrer Güte und Menschlichkeit beinahe überzeichnet. Sie sind es, die unter den fremden Mächten leiden, die Taiwan beherrschen – seien es nun Japaner oder KMT-Chinesen. Thome gelingt es so nicht, Spannung zu erzeugen: niemand hat Ambitionen oder macht Pläne, das einzige Geheimnis wird den Charakteren des Romans nicht aufgedeckt. Die eine (beinahe) tragische Gestalt ist der Bruder Umekos, der sich nach seiner unbegründeten Gefängnisstrafe wie Luke Skywalker in die Berge zurückzieht und dort Frieden sucht. Die Botschaft des Autors ergibt sich nicht aus dem Schicksal seiner Charaktere. “Alles, was der Text sagen will, formuliert er deutlich aus. Vielleicht wurde ‹Pflaumenregen› – anders als frühere Romane Thomes – auch darum nicht für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominiert. Das wäre dann eine durchaus richtige Entscheidung.” [K. Borchardt, Rezension für den SWR]. Wer Taiwan kennt, sieht allzu deutlich die mutwillige Provokation durch die Vergleiche der Kolonialmacht Japan und dem Expansionsstreben der Volksrepublik. Doch wer weder Stephan Thome noch die Insel kennt, findet in dem Buch eine kurze Geschichte Taiwans und bildreiche Unterhaltung.
‹Pflaumenregen›, Roman von Stephan Thome, erschienen 2021 bei Suhrkamp, ISBN 9783518430118, 526 Seiten, €25,00. Ein Blick ins Buch ist beim Verlag möglich (pdf).